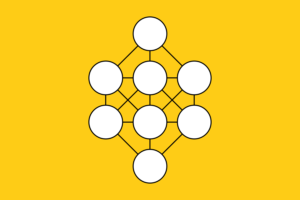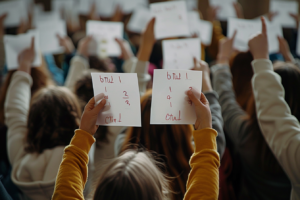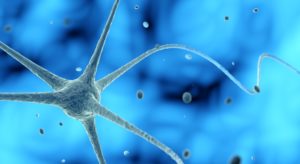Die meisten Lehrkräfte stimmen darin überein, dass Motivation ein wichtiger Faktor im Lernprozess ist. Weniger Einigkeit besteht darüber, ob und wodurch dieser Faktor beeinflussbar ist.
Manche Mathematiklehrkräfte sind da eher skeptisch. Sie glauben, dass Schülerinnen und Schüler entweder Spaß an Mathematik haben oder eben nicht, und dass die kleinen Tricks, mit denen die Lernenden zeitweilig motiviert werden, letztlich nichts an deren grundsätzlicher Einstellung zum Fach ändern würden. Auch auf die Frage, warum dies so sei, gibt es schnelle Antworten: Das hänge – von wenigen Ausnahmen abgesehen – weitgehend davon ab, ob ein Schüler oder eine Schülerin gut in Mathe sei oder nicht. Verhält es sich wirklich so?
Intrinsische und extrinsische Motivation
Die Unterscheidung von intrinsischer und extrinsischer Motivation ist recht geläufig. Intrinsische Motivation bezeichnet den Wunsch, aus innerem Antrieb um der Sache selbst willen etwas zu lernen. Von ihr zu unterscheiden ist die extrinsische Motivation, die aufgrund von äußeren Anreizen wie z. B. Belohnungen, Zensuren usw. zustande kommt. Lehrkräfte wünschen sich üblicherweise, dass ihre Schülerinnen und Schülern intrinsisch motiviert sind. Studien zeigen nämlich, dass sie dann eine Reihe pädagogisch erwünschter Verhaltensweisen an den Tag legen. Sie
- verweilen länger an den Aufgaben,
- erledigen diese auch ohne Aussicht auf eine (zusätzliche, extrinsische) Belohnung,
- wählen schwierigere Aufgaben aus,
- sind ausdauernder auch im Angesicht von Misserfolgen,
- bemühen sich um tieferes Verständnis,
- zeigen größere Kreativität und Risikobereitschaft,
- und interessieren sich für Optimierungsmöglichkeiten bei ihrem Vorgehen (z. B. durch Erlernen effizienterer Strategien).
Das klingt natürlich alles sehr wünschenswert! Es fragt sich daher:
- Wodurch werden Schülerinnen und Schüler überhaupt motiviert?
- Und was können wir als Lehrer tun, um sie in ihrer Motivation zu unterstützen? Können wir gar intrinsische Motivation fördern, oder ist sie “angeboren”?
Es gibt Tausende von Büchern, die das Thema Motivation aus Sicht der Psychologie, der Kognitionswissenschaften, des Behaviorismus usw. diskutieren. Ein kurzer Text wie dieser hier kann diese Komplexität nicht ansatzweise nachzeichnen. Das Thema ist aber auch zu relevant, um übergangen zu werden; denn Lernen und Motivation stehen in einer wichtigen, häufig aber auch missverstandenen Beziehung zueinander. Das gilt besonders für das Fach Mathematik.
Vier Faktoren der Motivation
Mathematik wird von Schülern und Eltern oft als schwieriges, bisweilen auch langweiliges Fach wahrgenommen. Diese Feststellung führt viele Lehrkräfte dazu, sich besonders viele Gedanken darüber zu machen, wie sie ihre Lernenden motivieren können. Dabei kommt es manchmal zu skurril anmutenden Maßnahmen, die am Ende mehr Schaden anrichten als dass sie nützen. Häufig liegt das an fehlerhaften oder folkloristischen Vorstellungen über die Wirkzusammenhänge von Motivation und Lernen. Werfen wir darum erst einmal einen Blick auf die wichtigsten Forschungsergebnisse zu diesem Thema. Studien haben vier Faktoren identifiziert, die für das Zustandekommen von Motivation maßgeblich sind:
1. Das Streben nach Selbstbestimmung
Ein wichtiger Faktor für Motivation ist das menschliche Streben nach Autonomie – der Wunsch, unser Leben selbst zu bestimmen. Gemäß der einflussreichen Selbstbestimmungstheorie von Ryan und Deci wirken sich externe Ereignisse wie Belohnungen, Bewertungen, Fristsetzungen und andere motivierende Inputs auf die intrinsische Motivation einer Person in dem Maße aus, wie sie die Wahrnehmung der Selbstbestimmung dieser Person beeinflussen. Hierin liegt eine Chance, aber auch eine Gefahr. Spitz formuliert: Wenn Menschen das Gefühl haben, dass jemand ihre Selbstbestimmung durch das Setzen von Anreizen verringert, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihre Motivation zunimmt, gering. Schlimmstenfalls kann es sogar zu Abwehrreaktionen kommen und damit das Gegenteil dessen bewirkt werden, was durch Anreize intendiert ist.
2. Der Glaube an den Wert
Die Überzeugung, dass die eigene Arbeit einen Wert hat, wird in Studien als zweiter wichtiger Faktor für Motivation genannt. Dabei geht es um den Wunsch nach persönlicher Weiterentwicklung, um das Verlangen, dass das, was wir tun, im Dienste von etwas steht, das größer ist als wir selbst oder schlicht um das Erhalten einer begehrten Belohnung. Im schulischen Kontext ist es von Bedeutung, wie sehr Schülerinnen und Schüler glauben, dass das, was sie lernen, nützlich, relevant oder sinnvoll ist. Dabei kommt es auf die Zuschreibung an, die die Lernenden vornehmen. Ein Lerninhalt, der für einen Großteil der Gesellschaft relevant ist, muss nicht automatisch auch für Schülerinnen und Schüler Bedeutung haben.
3. Das Streben nach Können
Ein drittes Element der Motivation ist das Streben nach Können – der Wunsch, in einer Sache, die als wichtig empfunden wird, immer besser zu werden. Schülerinnen und Schüler zeigen bei anspruchsvollen Aufgaben mehr Ausdauer und verarbeiten Informationen besser, wenn sie Können anstreben und nicht bloß Punkt- oder Ergebnisziele verfolgen. “Könnensorientierung” erklärt das Interesse der Schülerinnen und Schüler am Lernen, an der Entwicklung und Verbesserung neuer Fähigkeiten, am Verständniserwerb und an einer guten Arbeit um ihrer selbst willen und nicht nur wegen der Belohnungen oder der Noten, die sie für ihre Bemühungen erhalten.
4. Aussicht auf Erfolg
Untrennbar mit der Könnensorientierung verbunden ist die Aussicht auf Erfolg. Erfolgserlebnisse haben vor allem im Fach Mathematik einen großen, wenn nicht den größten Einfluss auf die Motivation von Schülerinnen und Schülern. Das Empfinden von Selbstwirksamkeit (d. h. der Glaube an die eigene Fähigkeit, in bestimmten Situationen erfolgreich zu sein oder eine Aufgabe zu bewältigen) ist demnach der Schlüssel zur Motivation. Er erklärt, dass Schülerinnen und Schüler, die sich als selbstwirksam empfinden,
- bereitwilliger und intensiver mitarbeiten,
- länger durchhalten
- und durch Schwierigkeiten weniger frustriert werden,
als diejenigen, die an ihren Fähigkeiten und Erfolgsaussichten zweifeln.
Folgerungen für den Mathematikunterricht
Diese vier Faktoren also sind es, die das Zustandekommen von Motivation im schulischen Kontext bestimmen. Wenn wir als Lehrkräfte unsere Schülerinnen und Schüler motivieren wollen, sollten wir ihnen entsprechende Erfahrungen ermöglichen oder vermitteln: Ein Gefühl von Selbstbestimmung, den Glauben, an etwas Wertvollem zu arbeiten, den Wunsch, etwas richtig gut zu können und die Aussicht und Erwartung, auch tatsächlich erfolgreich sein zu können.
Der letzte Punkt ist, wie schon angedeutet, für das Fach Mathematik besonders wichtig. Er klingt auch in den Einschätzungen der Lehrkräfte an, die sagen, dass Schülerinnen und Schüler Spaß an Mathematik haben, wenn sie gut darin sind. Die Forschungsergebnisse beschreiben dieses Empfinden etwas differenzierter und weniger absolut: Schülerinnen und Schüler müssen nicht “gut” im Fach sein, aber sie brauchen eine Erfolgserwartung. Und diese kann sich letztlich nur aus echten Erfolgserlebnissen speisen.
Wenn wir also die Motivation von Schülerinnen und Schülern fördern wollen, müssen wir vor allem dafür sorgen, dass sie Erfolge erleben.
Dabei muss es sich gar nicht um besonders gute Noten z. B. in Klassenarbeiten handeln. Auch kleine (aber regelmäßige) Erfolge zählen, wenn es um Motivation geht, wie z. B. eine kleine Teilaufgabe zu lösen oder ein Verfahren zu verstehen oder sicher anwenden zu können. Wichtig ist, dass die Lernenden immer wieder solche Erfolgserlebnisse haben.
Nach meinen Beobachtungen wird jedoch genau dieser Punkt im Unterricht viel zu oft vernachlässigt. Das hat u. a. damit zu tun, dass in den letzten Jahren Unterrichtsformen in den Schulen dominant geworden sind, die sich sehr stark auf den ersten der vier Faktoren konzentrieren (Selbstbestimmung) und weniger auf den vierten (Erfolgserwartung). Sie heißen “entdeckender Unterricht”, “offenes Lernen”, “Lernatelier”, “ko-konstruktivistisches Lernen” usw. Gemein ist diesen Formen, dass Schülerinnen und Schüler in ihnen vieles selbst tun, entscheiden und herausfinden müssen (für Details vgl. einen Aufsatz von Siegfried Uhl). Das geht manchmal sogar so weit, dass sie auch selbst darüber bestimmen dürfen, womit genau sie sich befassen (vgl. das Posting “Treffen die Lernenden die besseren Entscheidungen?”). Zugrunde liegt u. a. die Annahme, dass Schülerinnen und Schüler in solchen Formen authentischer, verantwortlicher, wirksamer und nachhaltiger lernen würden.
Fragwürdiger Fehlerkult
Im Zuge dieser Entwicklung wurde zunehmend die Bedeutung von Fehlern der Lernenden für den Lernprozess hervorgehoben. Dass Fehler eine produktive Wirkung haben können, war an sich schon lange bekannt und wurde auch von vielen Lehrerkräften ganz selbstverständlich und unaufgeregt genutzt.
Mittlerweile hat sich aber anstelle einer positiven Fehlerkultur so etwas wie ein “Fehlerkult” breit gemacht. An dessen Anfang standen neurowissenschaftliche Studien, in denen beobachtet wurde, dass das Gehirn eines Menschen, der beim Bearbeiten einer Aufgabe Fehler macht, stärkere Aktivitäten zeigt als das Gehirn einer Vergleichsperson, die die Aufgabe auf Anhieb richtig löst. Diese Beobachtung kann an sich auf unterschiedliche Weisen interpretiert werden.
Bei manchen Psychologen und Didaktikerinnen hat der Befund die Auffassung nahegelegt, dass im Fehler-Machen und Fehler-Zulassen der eigentliche Schlüssel zum erfolgreichen Lernen liege. Fortan wurde in zahlreichen Veröffentlichungen sowie Aus- und Fortbildungsmaßnahmen die Idee propagiert (und vermarktet), dass Lehrkräfte ihren Schülerinnen und Schülern möglichst „herausfordernde“ (also schwierige, Fehler provozierende) Aufgaben stellen und sich im dann einsetzenden Lern- und Lösungsprozess unter dem Paradigma des entdeckenden Lernens weitestgehend zurückhalten mögen. Die Lernenden würden zwar beim Versuch, die Aufgaben selbständig zu lösen, viele Fehler machen. Sie würden auch Mühen und Misserfolge aushalten müssen. Aber genau darin bestünde ja der Effekt, der zur höheren Aktivierung und mutmaßlich besseren Vernetzung im Gehirn beitrage und damit das Denken und Lernen fördere. Aufgabe der Lehrkräfte sei es, wiederum spitz formuliert, die Fehler der Lernenden zu tolerieren, sie für ihre Versuche zu loben, sie zu noch mehr Anstrengung aufzufordern und ihnen die Gewissheit zu vermitteln, dass sie auf diese Weise schließlich erfolgreich sein würden. Das Menschenbild des Neoliberalismus scheint hier durch.
Nun ist die Förderung von Selbstverantwortung und die Behandlung schwieriger Aufgaben an sich ja gar nichts Verkehrtes. Auch Appelle, an die Entwicklung der eigenen Kräfte zu glauben, sind gut gemeint (Stichwort Growth Mindset). Und natürlich ist der Wert und die Pflege einer fehlertoleranten Unterrichtskultur vollkommen unstrittig. Die Überbetonung von Praktiken, die viele Schülerinnen und Schüler immer wieder scheitern lassen, wie ich sie inzwischen in vielen Unterrichtsstunden beobachte, ist jedoch keine Motivationsförderung, sondern eine Fehlentwicklung, die auch in anderen Lebensbereichen mit Sorge beobachtet und kritisiert wird.
Inzwischen zeigen auch Studien, dass es keinen überzeugenden Grund gibt, an den Fehlerkult zu glauben. Im Gegenteil: Wiederholtes Scheitern motiviert nicht, sondern hemmt den Lernprozess. Was motiviert, sind Erfolgserlebnisse, die Lernende in der Auseinandersetzung mit Mathematik haben, u. a. bei der Überwindung von Fehlern. Bleiben sie aus, so stellt sich bei den Schülerinnen und Schülern bald die Erwartung ein, dass sie auch trotz fortgesetzter Anstrengungen keine Erfolge haben werden. Dies führt dazu, dass sie sich abwenden, d. h. dass sie nicht mehr aufpassen, keine Mühen mehr investieren und demzufolge auch nicht mehr lernen. Der psychologische Grund dafür liege, den Forschern zufolge, darin, dass die gehäuften Fehler- und Scheiternserfahrungen das Ego der Lernenden bedrohten und einen Vermeidungsmechanismus auslösten. Da hilft es auch nicht, den Schülerinnen und Schülern einzureden, dass sie es schon noch schaffen würden, wenn sie sich nur weiter anstrengten.
Diese Ergebnisse passen sehr gut zu älteren Befunden, wonach negatives Feedback das Vertrauen von Menschen in ihre eigenen Fähigkeiten unterminiere und ihre Erfolgserwartungen dämpfe.
Es gibt jedoch auch Fehler, die den Lernenden helfen können – das sind vor allem diejenigen, die sie nicht selbst gemacht haben.
Produktive Fehleranalyse statt Fehlerkult
Die Erfahrung, dass Fehler produktiv zum Lernprozess beitragen können, ist ja real und wird von vielen geteilt. Dies geschieht aber nur dann, wenn nicht das eigene Ego oder das persönliche Wohlbefinden der Lernenden bedroht ist. Ist das sichergestellt, bleiben sie offen für die in den Fehlern liegenden, oft wertvollen Botschaften. Die Auseinandersetzung mit fremden, jedoch Identifikation anbietenden Fehlern im Sinne einer konstruktiven Analyse ist jedoch eine Lerninterventionen ganz anderer Art, die ich dementsprechend an anderer Stelle besprechen werde.
Weitere Beiträge zu diesem Themenkreis

Die Frage der Motivation
Was motiviert Schülerinnen und Schüler für das Fach Mathematik?

Treffen die Lernenden die besseren Entscheidungen?
Im modernen Unterricht treffen Schülerinnen und Schüler häufig selbst die Entscheidung, was und wie sie lernen. Das soll ihre Motivation erhöhen. Ist es aber auch klug?

Wie motivierend sind Anwendungen?
Über die angeblich so motivierende Wirkung von Anwendungen und Modellierungen